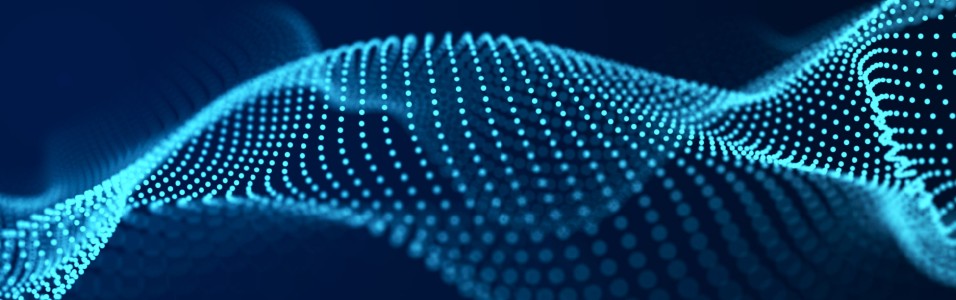Amprion plant schon heute das klimaneutrale Stromnetz für 2045. Um mögliche Herausforderungen dabei früh zu identifizieren, analysieren wir, wie es um die Versorgungssicherheit bestellt ist. Das heißt, wir betrachten die bestehende Infrastruktur und prüfen, ob sie eine sichere Energieversorgung leisten kann.
Inhalte der Studie
In unserer Studie zur Versorgungssicherheit in Deutschland betrachten wir aktuell folgende Aspekte:


Wir arbeiten daran zukünftig auch den Aspekt der Systemsicherheit und -stabilität in die Betrachtungen zu integrieren. Zu den genannten drei Aspekten gibt es viele Einzelstudien, aber keinen ganzheitlichen Überblick. Mit der Amprion-Versorgungssicherheitsstudie schließen wir diese Lücken und liefern neue Erkenntnisse.
Wie untersucht Amprion Versorgungssicherheit?
Amprion hat für die Versorgungssicherheitsstudie Methoden und Werkzeuge entwickelt, die dem Branchenstandard vorauseilen. Damit sind wir in der Lage, eine markt- und netzseitige Bewertung der Versorgungssicherheit eines Zieljahres in weniger als vier Tagen durchzuführen. Die Versorgungssicherheitsstudie stellt damit einen Meilenstein dar und bietet folgende Mehrwerte, die ihn von anderen Studien unterscheiden:
Probabilistische Szenarien
Anstelle eines einzigen, politischen Zielpfads nimmt die Amprion-Versorgungssicherheitsstudie eine Vielzahl möglicher Entwicklungen in den Blick. Das macht die Ergebnisse robuster.
Auftrittshäufigkeit von Netz-Situationen
Durch die Analyse hunderter Szenarien identifizieren wir Muster von Situationen, die das Netz herausfordern. So können wir auch besser vorhersagen, wann diese eintreffen.
Jährliche Betrachtung
Die lückenlose und ganzheitliche Betrachtung der kommenden zehn Jahre macht es uns möglich, Herausforderungen früh zu erkennen.
Mehr über Inhalt und Konzept der Studie im Video.
Zentrale Ergebnisse
- Das Niveau der marktseitigen Versorgungssicherheit nimmt über die Jahre deutlich ab. Die marktseitige Versorgungssicherheit ist ohne den Bau zusätzlicher Marktkraftwerke oder die Besicherung bestehender und zusätzlicher Reservekraftwerke über das Jahr 2031 hinaus nicht mehr zu gewährleisten.
- Das Redispatchvolumen und die Redispatchkosten sinken durch den fortschreitenden Netzausbau von 2028 bis 2030 temporär deutlich ab. Dadurch kann sich die politische Debatte in Bezug auf Preiszonen, Reservebedarfe und Netzentgelte verändern.
- Die Versorgungssicherheitsanalysen müssen kontinuierlich für die nächsten zehn Jahre durchgeführt werden, um zukünftigen Herausforderungen frühzeitig zu begegnen. Die Formalprozesse sollten entsprechend erweitert werden, um die Lücke zwischen Bedarfsanalyse und Netzentwicklungsplan zu schließen.
> mehr zur marktseitigen Versorgungssicherheit
> mehr zur netzseitigen Versorgungssicherheit
Das Webinar zur Versorgungssicherheitsstudie
In einem Webinar haben wir die Amprion-Studie zur Versorgungssicherheit im Detail vorgestellt. Hier finden Sie die Aufzeichnung.
Definitionen
Was ist marktseitige Versorgungssicherheit?
Die marktseitige Versorgungssicherheit ist gegeben, wenn Stromnachfrage und -erzeugung an den europäischen Strommärkten zu jedem Zeitpunkt ausgeglichen sind. Dies wird insbesondere in den nächsten Jahren zur Herausforderung, da einem steigenden Stromverbrauch sinkende steuerbare Erzeugungskapazitäten gegenüberstehen.
Mehr Details zu marktseitiger Versorgungssicherheit
Um das Niveau der Versorgungssicherheit zu quantifizieren, wird üblicherweise der Loss of Load Expectation (LoLE) herangezogen. Dieser Indikator gibt die durchschnittlich erwartete Anzahl an Stunden mit Lastunterdeckung in einem Jahr an. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und das luxemburgische Ministerium für Energie- und Raumplanung haben für die deutsch-luxemburgische Gebotszone gemäß Art. 25 Abs. 1 VO (EU) 2019/943 (Strombinnenmarkt-VO) im Jahr 2021 einen Zuverlässigkeitsstandard von 2,77 Stunden pro Jahr festgelegt. Die deutsch-luxemburgische Gebotszone gilt im Sinne des europäischen Rechts als versorgungssicher, wenn der Strommarkt in mehr als 99,96 Prozent der Stunden die Nachfrage vollständig decken kann. Wenn der Zuverlässigkeitsstandard als planerisches Werkzeug betrachtet wird, bedeutet dies: Es ist aus volkswirtschaftlicher Sicht günstiger, im Jahresdurchschnitt 2,77 Stunden Lastunterdeckungen zu akzeptieren, als Erzeugungskapazitäten zur Deckung der Stromnachfrage für diese Fälle zu errichten.
Der Zuverlässigkeitsstandard wird gemäß der Methodik des European Resource Adequacy Assessments (ERAA) verletzt, wenn der Grenzwert nach dem Einsatz bestehender Kapazitätsmechanismen – in Deutschland der Kapazitätsreserve – überschritten wird. In Deutschland gibt es weitere Reserven wie die Netzreserve oder besondere netztechnische Betriebsmittel (bnBm), die nicht als Kapazitätsmechanismus gelten, aber vor einer kontrollierten Lastabschaltung aktiviert werden.
Was ist netzseitige Versorgungssicherheit?
Die netzseitige Versorgungssicherheit ist gegeben, wenn der Stromtransport innerhalb Deutschlands unter der Berücksichtigung von Redispatch-Maßnahmen jederzeit engpassfrei erfolgen kann.
Mehr Details zu netzseitiger Versorgungssicherheit
Aufgrund der notwendigen Freischaltungen im Zuge des Netzausbaus und der steigenden Mengen an dezentral erzeugter Energie, muss ein zeitweise geschwächtes Stromnetz in der Transitionsphase steigende Transportaufgaben erfüllen. Im Rahmen der netzseitigen Versorgungssicherheit wird daher geprüft, ob Redispatch-Potenziale für einen sicheren Netzbetrieb der bestehenden Infrastruktur ausreichen. Das netzseitige Engpassmanagement (beispielsweise topologische Maßnahmen) wird dabei vorrangig zu Redispatch-Maßnahmen abgebildet. Ein behördlich definiertes Maß für das Niveau der netzseitigen Versorgungssicherheit gibt es im Gegensatz zur marktseitigen Versorgungssicherheit nicht.
Was umfasst Systemsicherheit und Stabilität?
Im Bereich der Systemsicherheit und -stabilität werden drei Kriterien beleuchtet:
Spannungsstabilität
Für den sicheren Betrieb des Übertragungsnetzes sind die Spannungen stets in einem vordefinierten Spannungsband zu halten. Die Spannungsstabilität ist gegeben, wenn die Spannung im gesamten Netz – auch in Folge von Einspeise- und Lastveränderungen oder Störungen – innerhalb der vorgegebenen Grenzen gehalten werden kann.
Frequenzstabilität
Die Frequenzstabilität beschreibt, inwiefern das elektrische Verbundsystem in der Lage ist, eine stationäre Netzfrequenz auch nach einer schweren Störung wiederherzustellen. Während die Frequenz bei einem Erzeugungsüberschuss ansteigt, sinkt sie infolge eines Mangels an Erzeugung im System. Die Frequenz muss innerhalb definierter Grenzen stabilisiert werden, um eine Schutzauslösung und Netztrennung von Erzeugungsanlagen und Lasten zu vermeiden.
Transiente Stabilität
Die transiente Stabilität ist gegeben, wenn das Stromnetz bei plötzlichen Laständerungen, Kurzschlüssen oder Schaltvorgängen in einen stabilen Arbeitspunkt zurückkehren und sicher weiterbetrieben werden kann. Durch die Simulation transienter Phänomene können potenziell nicht beherrschbare Störereignisse frühzeitig identifiziert und entsprechende Gegenmaßnahmen entwickelt werden, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Dies ist entscheidend, um das Netz vor instabilen Zuständen zu schützen und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.