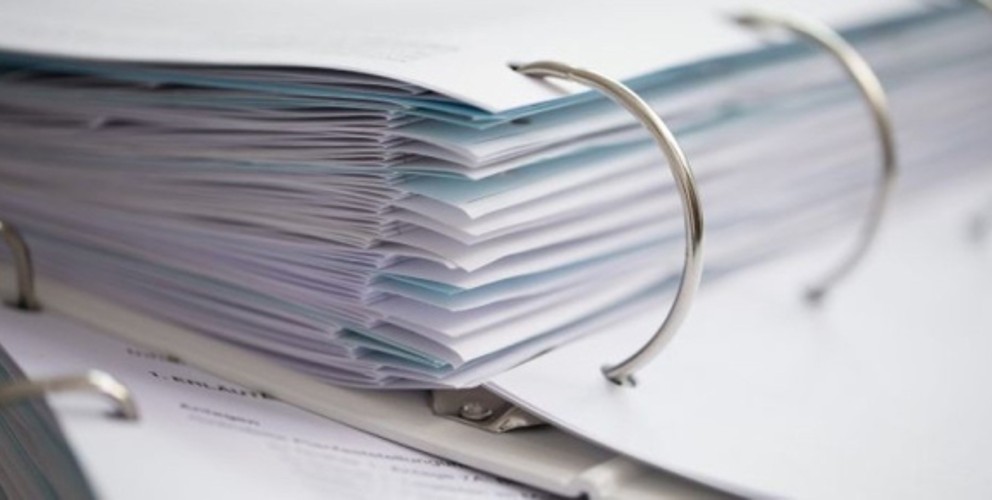Batteriespeicher: Alte Anschlussregeln passen nicht mehr
Energiewirtschaft
Netzplanung
Lesedauer: 3 Min.
Das bisherige „Windhundverfahren“ ist angesichts der Antragsflut von Batteriespeicher-Betreibern nicht mehr geeignet, sagen die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber. Sie möchten bis Herbst 2025 einen eigenen Vorschlag machen.
In den vergangenen drei Jahren sind bei den vier deutschen Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) in Summe etwa 700 Netzanschlussanfragen von Batteriespeicher-Betreibern eingegangen – mit einer Leistung von insgesamt rund 250 Gigawatt. Das ist das Sechsfache der im Szenariorahmen des Netzentwicklungsplans 2037/2045 (2025) angenommenen Leistung. Allein Amprion hat inzwischen rund 250 Anfragen erhalten.
700
Netzanschlussanfragen
von Batteriespeicher-Betreibern in den vergangenen 3 Jahren

Zeitliche Entkopplung macht das System flexibler und resilienter.
Dr. Hendrik Neumann
-
CTO der Amprion GmbH

Viele Batteriespeicher-Anfragen werden am Ende nicht realisiert, blockieren aber Ressourcen.
Stephan Morgenschweis
-
Leiter Customer-Management bei Amprion